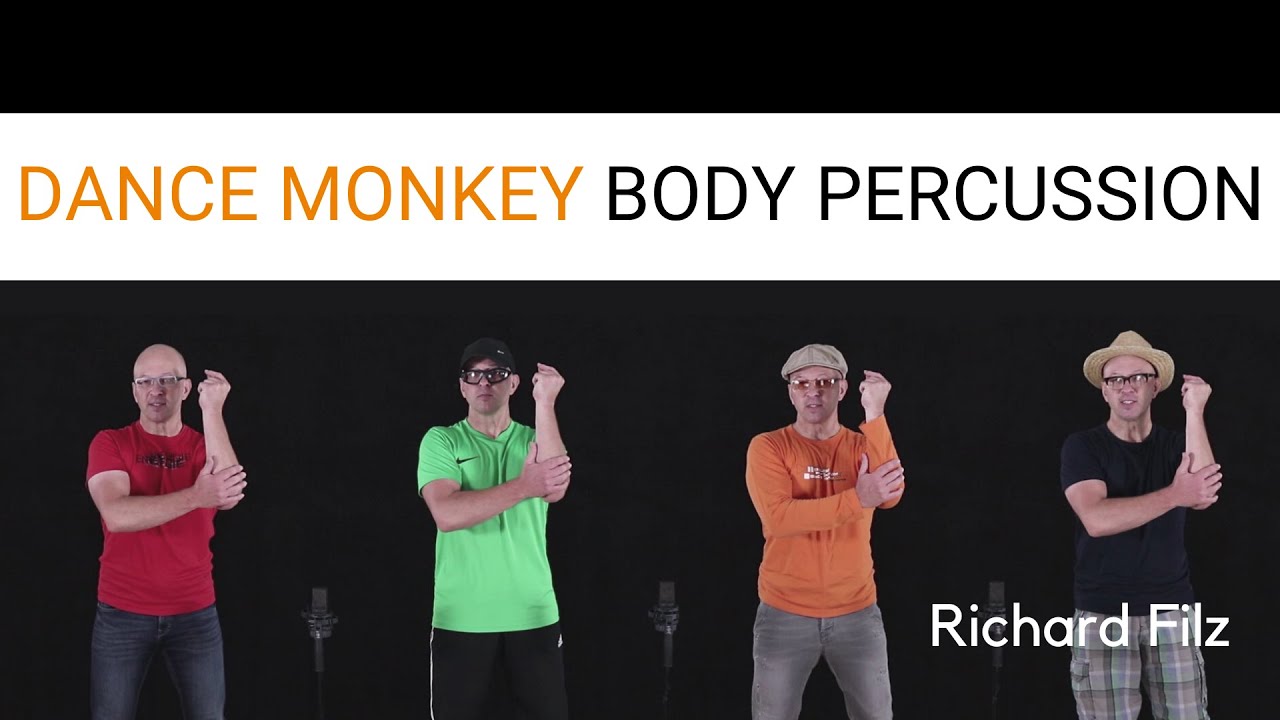Ich habe nach dem Auer- Sprachbuch gearbeitet, das so vorgeht:
- Arbeiten an Rechtschreibstrategien mit dazugehörigem Wortschatz
- Der Wortschatz wird in nachfolgenden Texten und Kapiteln immer wieder aufgegriffen
- Die Besonderheiten waren, dass man mit Rechtschreibsymbolen ähnlich der FRESCH - Methode arbeitete
- In der Grammatik wurden die Wortarten mit Montessorisymbolen gekennzeichnet ( bei der Groß- und Kleinschreibung hilfreich)
- Das Buch arbeitet nach dem (bayerischen) Grundwortschatz
Durch die schwerpunktmäßige Bewusstmachung der Rechtschreibstrategien, das Einprägen und Wiederholen der Lernwörter, die immer wieder zusammenfassende Sicht auf Rechtschreibstrategien wurde die Rechtschreibung in meinen Augen gut eintrainiert. Besonders sinnvoll fand ich die Arbeit mit Symbolen und das dadurch verknüpfte Überlegen.
Rechtschreibstrategien gibt es auf verschiedenen Ebenen: Silben, Regeln, grammatikalisch usw.
Zusätzlich habe ich noch Lernwörterlisten passend zum Buch an die Schüler herausgegeben. Dazu gab es dann noch verschiedene Übungen, oft strategiegeleitet oder etwas zur Grammatik oder man musste bestimmte Wörter im Wörterbuch suchen.... usw.
Abschreibtexte spielten bei der Rechtschreibvermittlung nur eine untergeordnete Rolle, weil sie nur auf die optische Wahrnehmung gehen.
Karteikarten können unterschiedlich angelegt werden. Mit dem 5 Karteiensystem habe ich bei individuell immer falsch geschriebenen gängigen Wörtern gearbeitet; das war sozusagen eine individuelle Rechtschreibkartei.
Zusammenfassend: systematische Rechtschreibung und Lernwörter, also die Automatisierung.
Ich habe den Ansatz des Buches ausprobiert, weil er mir zielgerichtet erschien und er hat funktioniert. Vorher hatten wir nach dem Konzept von Steinleitner gearbeitet - deren Rechtschreibansatz wurde ab 2000 in Bayern verbreitet. Diese orientierte sich fast nur an Strategien und wenig an dem systematischen Eintrainieren des Grundwortschatzes. (Das Material dazu war oft spielerisch aufgebaut und hat aber nicht ausgereicht.) Das Eintrainieren mit Wörterlisten haben wir bald noch dazugemacht.
Der Fortschritt des oben genannten Ansatzes von Auer ist die Symbolik und der in meinen Augen noch bessere didaktische Aufbau, der vieles berücksichtigt. Außerdem arbeiten wir laut Lehrplan nun verstärkt mit Silben.