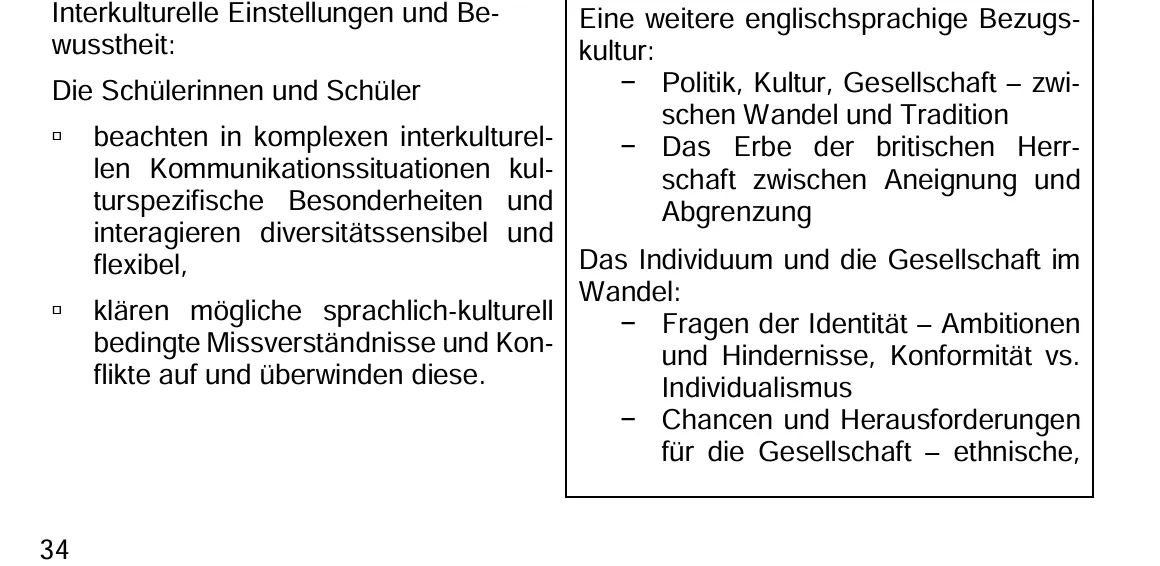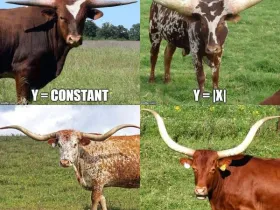Die Diskussion verfehlt m.E. das eigentliche epistemologische Kernproblem: Die Präferenz für Schokoladeneis versus Vanilleeis kann – zumindest jenseits einer trivial-hedonistischen Geschmackserfahrung – nicht als kategorial stabile Größe verstanden werden. So wenig, wie (außerhalb einer eventuell dritten Verkostungs-Iteration) die individuelle Affektlage als legitimer Maßstab gelten kann, dürfte es hier um einen performativ-sensorischen Akt gehen, der die subjektive Geschmacksrealität der probierenden Person affirmiert. Das wäre dann gerade nicht das Ziel einer „möglichst objektiv-deskriptiven“ Geschmacksanalyse.
Insofern es bislang keine deskriptiv-kulinarische Norm gibt, die die Einordnung von Eiscremepräferenzen entlang einer kakaobasierten oder vanillinzentrierten Achse zwingend vorschreibt, ist es methodologisch nicht unhaltbar, auch alternative Kategorisierungen (z. B. auf Basis der Textur, Schmelzgeschwindigkeit oder metaphorischen Farbsymbolik) anzuwenden. Dass einige Rezipienten hierbei kulinarische Sozialisationseffekte (etwa: frühe Exposition gegenüber industriell standardisierter Eiscreme in Polypropylenbechern) mit transkultureller Universalität verwechseln, ist ein semantisches wie epistemisches Missverständnis. Sollte, man würde meinen, zumindest gastronomischen Hermeneutikern und im speziellen Fall Diätetik-Didaktikern nicht passieren.
Im Übrigen ist die unreflektierte Reproduktion normativer Dessertdiskurse („Vanille = klassisch“, „Schoko = sündig“) symptomatisch für eine zunehmende Entdifferenzierung des sensorischen Diskurses im öffentlichen Raum. M.E. ein weiteres Indiz für den semiotischen Niedergang genuiner Geschmackskompetenz (ach… die gute alte sensorische Phänomenologie…). Aber das führt jetzt zu weit.